Realien: Materialien von Anton Hafner (KZU Bülach)
1 fauces 1a vestibulum 2 cella 3 atrium 4 impluvium 5
cubiculum 6 ala 7 tablinum 8 oecus (triclinium) 9 apotheca
10 andron 11 peristylium 12 posticum 13 cubiculum 14 exedra
(Prunksalon) 15 oecus (Salon, Speisezimmer) Im Verlaufe des 2. Jhdt.
wird das Haus - wiederum axialsymmetrisch um das Peristyl
(11) erweitert - oft mit axialsymmetrischen Durchblicken
vom Atrium ins Peristyl gebaut. Dieses bildete als zentraler
Hof den Kern des hellenistischen Hauses (bekannt z.B. aus Delos).
In Italien wird es zu einem Garten, der eingefasst ist
mit dorischen oder ionischen Säulen, die ein Pultdach
tragen und so eine gedeckte porticus
(Säulenumgang) bilden. Natürlich konnte sich nicht
jedermann ein Haus mit Peristyl leisten. Ausserdem musste
der Baugrund verfügbar sein, um das Haus zu erweitern.
Oft wurde dann der alte Garten zu einer Art Rumpfperistyl
umgebaut.
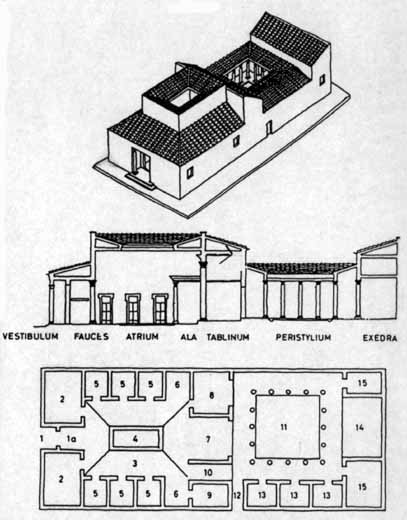
Als Kontrast dazu erhält das Atrium an den Ecken des
Impluviums oft vier korinthische Säulen. Ein solches
Atrium nennt man atrium
tetrastylum. (Möglich
sind auch mehrere dorische Säulen am Rand des
Impluviums: atrium corinthicum)
Das Peristyl bietet die Möglichkeit zu Erweiterungen.
Folge davon ist, dass die eigentlichen Wohnräume der
Familie nach hinten auswandern. Atrium und Tablinum werden
zu Empfangs- und Durchgangsräumen.
Pompeji, Casa dei Vetti
Peristyl
Zurück zur Übersicht Pompeji